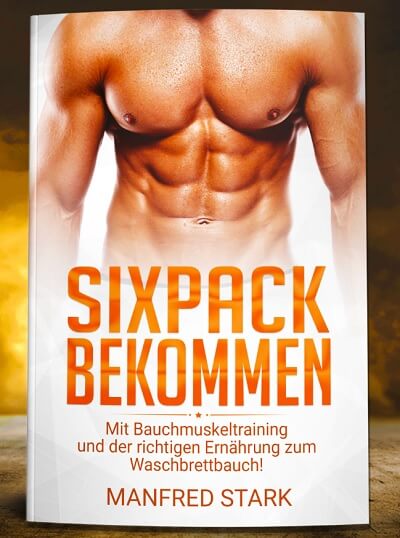Im Gymnastikball Test soll dieses schlichte, jedoch besonders vielseitige Sportgerät vorgestellt werden. Oft wird der Gymnastikball jedoch mit dem Sitzball verwechselt. Hier findest du deshalb Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Thema.
Dabei geht es um Dinge wie: Was ist der Unterschied zwischen einem Gymnastikball und einem Sitzball? Welcher Gymnastikball ist im Testbericht der Testsieger? Welches Modell schneidet bei Erfahrungen, Bewertungen und Kundenrezensionen besonders gut ab? Welche anderen Dinge solltest du beim vergleichen von verschiedenen Modellen beachten, wenn du einen Gymnastikball kaufen willst?
Die Antworten auf diese Fragen, sowie viele weitere nützliche Dinge erfährst du im Verlauf von diesem Gymnastikball Vergleich.


Inhaltsverzeichnis
- 1 Gymnastikball, Pezziball, Sitzball – Ist alles das Gleiche?
- 2 Was sind die Unterschiede zwischen Gymnastikball und Sitzball?
- 3 Kann ein Sitzball als Gymnastikball (und umgekehrt) genutzt werden?
- 4 Wann kannst du Gymnastikbälle und Sitzbälle nutzen?
- 5 Für wen sind Gymnastikbälle und Sitzbälle ungeeignet?
- 6 Wie läuft das richtige Training ab?
- 7 Motivation für das Training
- 8 Welche Kaufkriterien gelten für einen Gymnastikball?
- 8.1 Wie viel kosten Gymnastikbälle und Sitzbälle?
- 8.2 Welche Farbe sollte ein Sitzball oder ein Gymnastikball haben?
- 8.3 Aus welchem Material sollten Gymnastikbälle und Sitzbälle bestehen?
- 8.4 Achte auf Weichmacher
- 8.5 Die richtige Materialstärke und Belastbarkeitsgrenze
- 8.6 Welche Größe sollte der Ball haben?
- 9 Welches Zubehör solltest du kaufen?
- 10 Bekannte Hersteller
- 11 Andere Sportbälle
Gymnastikball, Pezziball, Sitzball – Ist alles das Gleiche?
Im Zusammenhang mit Gymnastikbällen fallen immer wieder die Begriffe Pezziball und Sitzball. Dies kann schnell dazu führen, dass alle drei Begriffe für die selbe Art von Bällen verwendet wird. Doch stellt sich zunächst die Frage, ob dies auch so seine Richtigkeit hat. Die Antwort ist ein klares Jain. Die Begriffe Gymnastikball und Pezziball sind Synonyme.
Der Begriff Pezziball ist ein Deonym für Gymnastikbälle. Deonyme sind Begriffe, die sich ursprünglich auf eine bestimmte Sache bezogen, sich nun auf alle Dinge des gleichen Typs beziehen. Ein bekanntes Beispiel ist Tempo für alle Papiertaschentücher, unabhängig davon, von welchem Hersteller sie stammen. So ist der Pezziball der Produktname der ersten Gymnastikbälle, die es je gab, welche im Jahr 1950 von der italienischen Firma Ledragomma hergestellt worden sind.
Während also der Pezziball letztlich genau das Gleiche ist, wie ein Gymnastikball, sieht dies beim Sitzball ganz anders aus. Sowohl Gymnastikbälle, als auch Sitzbälle bestehen aus etwas unterschiedlichen Materialien und haben unterschiedliche Materialeigenschaften.
Aus diesem Grund verhalten sie sich bei Belastung unterschiedlich und sind deshalb auch für die unterschiedlichen Einsatzzwecke als Sportgerät und als Sitzmöbel gedacht. Was die genauen Unterschiede sind und welcher Ball in welchem Fall die Kaufempfehlung ist, findest du im folgenden Abschnitt.
Was sind die Unterschiede zwischen Gymnastikball und Sitzball?
Die Antwort auf diese Frage könnte einfach lauten, dass sowohl Gymnastikbälle, als auch Sitzbälle für verschiedene Dinge genutzt werden. Doch diese Antwort wäre in diesem ausführlichen Gymnastikball Vergleich etwas zu einfach. Der größte Unterschied zwischen Gymnastikbällen und Sitzbällen ist das Material und vor allem die Stärke des Materials, aus dem sie gefertigt sind.
Da Gymnastikbälle für den Sport gedacht sind, ist davon auszugehen, dass sie besonders stark belastet werden. Aus diesem Grund wären Modelle aus dünnem Material schlechter zu bewerten. Hier ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Ball platzt.
Vor allem bei sehr komplizierten Übungen besteht in einem solchen Fall ein sehr hohes Verletzungsrisiko. Deshalb sind Gymnastikbälle aus sehr robustem Material hergestellt. Die Dicke der Hülle kann dabei bis zu 3 cm dick sein. Besonders hochwertige Gymnastikbälle erreichen dadurch eine Belastungsgrenze von bis zu 500 kg.
Im Gegensatz zu einem Gymnastikball muss ein Sitzball eine wesentlich geringere Belastung aushalten. Bei sorgfältigem Umgang entspricht die Belastung, welcher ein Sitzball ausgesetzt ist ungefähr deinem Körpergewicht. Deswegen muss ein Sitzball auch nicht aus einer so dicken Materialschicht hergestellt sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Erfahrung nach, dass ein Sitzball niemals so prall aufgepumpt wird oder, besser gesagt, nicht so prall aufgepumpt werden sollte, wie ein Gymnastikball. Ein weniger aufgepumpter Ball platzt selbstverständlich bei Belastung auch nicht so leicht, weil die Kraft, die auf ihn wirkt, keinen so hohen Druckanstieg bewirkt, da sich die Luft im Ball weiter verteilen kann.
Kann ein Sitzball als Gymnastikball (und umgekehrt) genutzt werden?
Diese Frage ist nicht ganz klar zu beantworten, da es auf die genaue Situation ankommt. Da Gymnastikbälle und Sitzbälle unterschiedliche Eigenschaften haben, sind sie grundsätzlich speziell für die eine oder die andere Nutzung gedacht. Doch um das genauer auszuführen, muss erst erörtert werden, wofür Gymnastikbälle und Sitzbälle eigentlich gedacht sind.
Die Nutzung von einem Sitzball
Den Sitzball solltest du, wie der Name bereits sagt, möglichst nur als Sitzgelegenheit nutzen. Dabei sollen Sitzbälle andere Sitzmöbel wie Stühle ersetzen. Dies ist jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. Zwar wirkt sich der Sitzball sehr positiv auf die Körperhaltung und die Stärke sehr vieler Muskelgruppen, insbesondere denen des Rumpfes aus. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn der Ball korrekt und vor allem bewusst genutzt wird.
Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies in der Regel nicht der Fall ist. In den meisten Fällen hat sich gezeigt, dass nach einer gewissen Zeit sich eine Sitzposition einstellt, welche kaum noch ausbalanciert werden muss und somit die Muskulatur sowie den Gleichgewichtssinn nicht mehr fordert. Das Resultat ist dann eine zunehmend falsche Körperhaltung. Aus diesem Grund sollte der Sitzball von ungeübten Personen nie länger als 30 Minuten am Stück genutzt werden.
Bei geübten Personen, die den Sitzball nicht mehr zum Aufbau einer kräftigen Rumpfmuskulatur nutzen, sondern nach langfristigem Training diese nur erhalten wollen, ist zu empfehlen, dass maximal ein Drittel der gesamten Zeit, die täglich im Sitzen verbracht wird, ein Sitzball als Sitzgelegenheit genutzt wird.
Falls der Sitzball zu ausgiebig genutzt wird, sind Krämpfe und Verspannungen der Rückenmuskulatur die kurzfristigen und mittelfristigen Folgen. Auf Dauer können Fehlstellungen der Wirbelsäule und dauerhafte Probleme des Bewegungsapparats die Folge einer übertriebenen Nutzung sein.
Als Gymnastikball kann ein Sitzball genutzt werden, jedoch nur mit Einschränkungen. Einerseits wird ein Gymnastikball stärker belastet, wofür die dünnere Hülle von Sitzbällen nicht ausgelegt ist. Die Folgen können ein Platzen des Balls und daraus resultierende Unfälle sowie Verletzungen sein. Das Training ist jedoch in jedem Fall weniger effektiv, da du einen Sitzball nicht so prall aufpumpen solltest, wie einen Gymnastikball. Die daraus resultierende geringere Festigkeit erschwert Übungen und macht sie weniger wirksam.
Die Nutzung von einem Gymnastikball
Während du einen Sitzball zumindest mit Einschränkungen als Gymnastikball verwenden kannst, ist von der umgekehrten Nutzung eines Gymnastikballs als Sitzball strikt abzuraten. Das größte Problem ist, dass der Gymnastikball wesentlich praller aufgepumpt wird. Dadurch wird er sehr viel härter als es bei einem Sitzball üblich ist. Doch selbst bei geringerer Füllung ist ein Gymnastikball deutlich härter. Dies liegt an der deutlich dickeren und somit festeren Hülle. Die Folge ist eine zu starke Belastung des Rückens.
Ein weiteres Problem ist die Größe. Gymnastikbälle sind in der Regel größer als Sitzbälle. Da beim Training der gesamte Körper viel bewegt wird, bereitet der Größenunterschied bei Sitzbällen keine großen Schwierigkeiten. Umgekehrt ist dies jedoch der Fall, da die sitzende Position wesentlich weniger Bewegung erfordert und somit eher zu einer längerfristig falschen Körperhaltung führt.
Wann kannst du Gymnastikbälle und Sitzbälle nutzen?
Entsprechend den unterschiedlichen Anwendungsgebieten solltest du Gymnastikbälle und Sitzbälle gemäß ihrer Bestimmung nutzen. Der Gymnastikball ist, wie bereits erwähnt, nur zum Training gedacht und du solltest ihn auch entsprechend nutzen. Dadurch ist er lediglich ein Sportgerät, welches du ansonsten außerhalb deiner Trainingseinheiten irgendwo verstauen kannst.
Einen Sitzball kannst du hingegen sowohl zuhause, als auch im Büro als alternative Sitzgelegenheit nutzen. Hierbei solltest du jedoch bedenken, dass du vor allem im Büro den Ball spontan aufpumpen und später nach der Nutzung wieder leeren oder so wegräumen musst, dass er nicht im Weg ist. Da die Nutzung nicht länger als eine halbe Stunde sein sollte, musst du diese sinnvoll mit deiner Arbeit abpassen oder du solltest mit deinem Chef und eventuellen Kollegen im gleichen Raum kurz abklären, ob niemand etwas dagegen hat.
Können Kinder und Schwangere Gymnastikbälle und Sitzbälle nutzen?
Die Nutzung der Bälle ist für Kinder und Schwangere teilweise möglich. Da Sitzbälle voraussetzen, dass eine gesunde Körperhaltung durch das Anspannen von Muskeln eingehalten wird, sollten Kinder nicht auf Sitzbällen sitzen. Bereits für ungeübte Erwachsene ist das Aufrechterhalten der Muskelspannung eine Herausforderung. Kinder haben einen noch flexibleren Bewegungsapparat und in der Regel eine deutlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne.
Dies führt dazu, dass sie eine korrekte Körperhaltung für eine viel zu kurze Zeit einhalten können, als dass ein Sitzball Sinn machen würde. Sobald sie sich an eine bequeme Körperhaltung gewöhnt haben, ist es zu einer dauerhaften Fehlstellung der Wirbelsäule und anderen Teilen des Bewegungsapparats mit langfristigen oder sogar Dauerhaften Folgen nicht mehr weit.
Gymnastikbälle sind für Kinder hingegen recht gut geeignet. Kinder werden Gymnastikbälle selbstverständlich nicht für ausgedehnte und korrekte Trainingseinheiten nutzen. Doch alleine das Spiel mit den großen Gymnastikbällen macht selbst den Kleinsten viel Spaß. Es reicht dabei vollkommen, wenn sie den Ball durch die Gegend schießen oder werfen.
Die robusten Gymnastikbälle bieten einen gewissen Widerstand, sodass einerseits der ganze Körper des Kindes kräftiger wird und sich besser entwickelt und gleichzeitig fördert die Koordination zwischen den Augen und den Gliedmaßen die Entwicklung des Gehirns.
Schwangere profitieren hingegen sowohl von Sitzbällen, als auch von Gymnastikbällen. Die veränderte Gweichtsverteilung führt in fast allen Fällen aufgrund der ungewohnten Körperhaltung und daraus resultierenden Verspannungen zu mehr oder weniger großen Rückenschmerzen. Wird jedoch frühzeitig während der Schwangerschaft ein Sitzball zur Stärkung der Rückenmuskulatur und ein Gymnastikball zur Stärkung des gesamten Körpers genutzt, kann dadurch Rückenproblemen frühzeitig vorgebeugt werden.
Auch nach der Geburt ist die Nutzung sinnvoll, da hierdurch die Rückbildung gefördert wird. Lediglich bei bekannten oder befürchteten Komplikationen oder in den letzten Wochen der Schwangerschaft sollte die Nutzung der Bälle mit einem Arzt oder Physiotherapeuten abgesprochen werden.
Für wen sind Gymnastikbälle und Sitzbälle ungeeignet?
Solltest du unter Schwindel leiden, dann sind Gymnastikbälle und Sitzbälle für dich ungeeignet. Du wirst wahrscheinlich Probleme mit dem Gleichgewicht bekommen, wodurch das Risiko von Stürzen hoch ist. Probleme mit der Hüfte und den Knien können ebenfalls, müssen jedoch nicht zwingend, ein Ausschlusskriterium sein. Hier ist die Rücksprache mit einem Arzt oder Physiotherapeuten unverzichtbar.
Das Gleiche gilt für alle anderen Einschränkungen des Bewegungspapparates. Nach oben hin besteht prinzipiell keine Altersgrenze, sofern die allgemeine körperliche Verfassung eine Nutzung zulässt. Einzig das erhöhte Verletzungsrisiko bei Stürzen sollte unbedingt beachtet werden.
Wie läuft das richtige Training ab?
Die Nutzung von einem Sitzball ist grundsätzlich nicht als Training zu verstehen, auch wenn eine Kräftigung der Rumpfmuskulatur das langfristige Ziel ist. Aus diesem Grund ist die Nutzung verhältnismäßig einfach und kann von jedem (selbstverständlich außer den zuvor als ungeeignet genannten Personen) genutzt werden.
Die Nutzung besteht darin immer wieder das Gleichgewicht zu halten und vor allem bei Bewegungen auf dem Ball eine Sitzposition zu halten, die nicht in einem Sturz endet. Gleichzeitig soll eine möglichst aufrechte Körperhaltung aufrecht erhalten werden. Diese kräftigt ebenfalls die gesamte Rumpfmuskulatur. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Rückenmuskulatur.
Hier werden insbesondere die Muskeln des Lendenbereichs gestärkt. Auch kleine Muskeln, die in den tieferen Schichten liegen und selbst bei vielen bewussten Übungen kaum trainiert werden, kräftigt die Nutzung eines Sitzballs.
Das Training mit einem Gymnastikball ist hingegen als echter Sport anzusehen und deshalb nicht ganz so einfach. Um Sport jeglicher Art korrekt zu betreiben sind umfassende Kenntnisse über den menschlichen Körper unverzichtbar.
Wenn dir dieses Wissen fehlt, kann es ganz leicht passieren, dass kleinere Fehlstellungen deines Skeletts oder eine ungleiche Kraftverteilung deiner Muskeln zu ungünstigen Körperhaltungen beim Training führen. Dies wiederum kann darin resultieren, dass du Fehlstellungen und sonstige Ungleichgewichte nicht behebst, sondern sich diese durch fehlerhaftes Training zu echten Problemen manifestieren.
Es ist leider nicht möglich dir im Zuge dieses Ratgebers ausführliche Tipps zum korrekten Training mit einem Gymnastikball zu geben. Auch wären Trainingstipps deplatziert, da diese nicht das eigentliche Thema von diesem Gymnastikball Vergleich sind. Aus diesem Grund solltest du dich gesondert informieren, was gute Übungen für dich sind und wie du diese korrekt durchführst. Es ist dabei zu empfehlen, dass du hierfür nicht das Internet nutzt.
Zwar ist die Fülle an Informationen riesig und du wirst auch Tipps von wirklich kompetenten Personen finden, jedoch ohne Vorwissen nicht unterscheiden können, welche Personen inkompetent sind. Aus diesem Grund ist die beste Lösung zumindest zu Beginn der Übungen einen professionellen Trainer im Fitnessstudio oder einen ausgebildeten Physiotherapeuten um Rat zu fragen. Beide haben das benötigte Fachwissen und sind auch dazu in der Lage Fehlstellungen zu erkennen und, sofern dies nötig sein sollte, direkt zu beheben.
Motivation für das Training
Eine allgemein bekannte Volksweisheit besagt: Sport ist Mord. Falls du selber also kein bereits über Jahre hinweg aktiver und motivierter Sportler bist, reicht es nicht unbedingt aus einen Gymnastikball zu kaufen. Nach einigen guten Vorsätzen und ein paar höchst motivierten Trainingseinheiten landet der Ball in der Ecke, in der Abstellkammer oder im Keller. Damit dies nicht passiert, musst du dir von Anfang an überlegen, wie du dich motivieren kannst.
Am besten ist es, wenn du dir bereits vor dem Kauf feste Ziele setzt und diese beim Training konsequent verfolgst. Ein Trick hierbei ist es dir nicht ein einzelnes großes Ziel zu setzen, welches am Anfang unerreichbar und nach Wochen oder Monaten noch immer in weiter Ferne liegt, sondern dir viele kleine Zwischenziele zu überlegen, die du sowohl überblicken, als auch in absehbarer Zeit erreichen kannst.
Gute Beispiele hierfür ist das Messen der Zeit, wie lange du eine bestimmte Körperhaltung aufrecht erhalten kannst oder die Anzahl der Wiederholungen einer Übung. Stelle dir hierfür einen Trainingsplan zusammen. Selbst wenn dir einmal die Motivation fehlt, dann kannst du diesen noch immer als Verpflichtung betrachten und dich dazu zwingen dieser nachzukommen. Schreibe ein Tagebuch oder zumindest einen Notizzettel und halte deine Erfolge mit Datum darauf fest.
Versuche den Trainingsplan abwechslungsreich zu gestalten. Es ist bekannt, dass Muskeln nicht während des Trainings aufgebaut werden, sondern in den Tagen danach, wenn kleinere Risse (Muskelkater!) repariert und der Muskel mit neuen Muskelfasern zum Schutz vor zukünftigen Schäden verstärkt wird. Deshalb macht es ohnehin mehr Sinn bei mehrmals wöchentlichen oder sogar täglichen Trainingseinheiten jeweils andere Muskelgruppen zu trainieren.
Welche Kaufkriterien gelten für einen Gymnastikball?
Wenn du dich nun für den Kauf von einem Sitzball oder von einem Gymnastikball entschieden hast, dann geht es darum ein Modell zu finden, welches qualitativ hochwertig ist und zu dir passt.
Es gibt dabei eine ganze Reihe von Dingen, die du beachten musst. Gleichzeitig sind diese Dinge nicht allzu schwierig zu überprüfen und du findest sie schnell in der Produktbeschreibung der Bälle.
Wie viel kosten Gymnastikbälle und Sitzbälle?
Eine gute Sache haben Gymnastikbälle und Sitzbälle an sich, für den Fall, dass du dir noch unsicher bist, ob ein Sitzball oder ein Gymnastikball etwas für dich ist. Die Kosten für beide Varianten sind so gering, dass du es einfach ausprobieren kannst. Selbst wenn du noch unsicher bist, wirst du wahrscheinlich bald Gefallen daran finden, sobald du den Ball erst einmal hast und ihn ausprobierst.
Die durchschnittlichen Kosten liegen bei rund 15 bis 25 Euro. Dabei kommt es in erster Linie darauf an, ob du dich für einen Sitzball oder für einen Gymnastikball entscheidest. Wie bereits erwähnt worden ist, sind Sitzbälle aus einer dünneren Materialschicht gefertigt als Gymnastikbälle. Aus diesem Grund sind Sitzbälle eher günstiger als die robusteren Gymnastikbälle. Die preislichen und qualitativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen bekannter Hersteller sind dagegen eher zu vernachlässigen.
Welche Farbe sollte ein Sitzball oder ein Gymnastikball haben?
Gymnastikbälle und Sitzbälle sind von durchsichtig, über Weiß, alle Farben des Regenbogens, bis hin zu Schwarz und bunt gemustert erhältlich. Dies kann die Wahl zu einer echten Qual machen. Das Gute daran ist jedoch, dass es in den meisten Fällen gar keinen Unterschied macht, für welche Farbe du dich entscheidest.
Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Qualität, somit hast du grundsätzlich freie Wahl. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen. Einerseits ist ein Sitzball einem Sitzmöbel entsprechend. Dadurch solltest du ihn deiner Einrichtung angepasst kaufen, sofern du nicht bewusst einen Farbtupfer als Akzent setzen willst.
Diese Frage stellt sich jedoch eher einem Einrichtungsberater. Wichtiger ist die Farbe bei den Bällen für Kinder. Wenn einem Kind der Ball nicht gefällt, dann geht das Interesse sehr schnell verloren. Hier gibt es auch speziell Modelle, die mit bunten Motiven bedruckt sind.
Aus welchem Material sollten Gymnastikbälle und Sitzbälle bestehen?
Da sowohl Sitzbälle, als auch Gymnastikbälle in gewissem Umfang flexibel und dehnbar sein müssen, ist es unverzichtbar, dass die Hersteller entsprechende Kunststoffe für die Herstellung wählen. Es wird sicherlich einige Hersteller mit einzelnen Modellen geben, die eigene Materialien für die Herstellung nutzen oder zumindest ausprobieren werden, jedoch wird dies eine verschwindend geringe Minderheit sein.
Aus diesem Grund sollen diese Ausnahmen auch an dieser Stelle vernachlässigt werden. Der mit Abstand größte Anteil der Gymnastikbälle und Sitzbälle wird aus dem Kunststoff PVC hergestellt sein. Dieser Kunststoff erfüllt alle Anforderungen an die Belastbarkeit, Festigkeit, Dehnbarkeit und Flexibilität am Besten. Du wirst also auf deiner Suche nach einem geeigneten Sitzball oder Gymnastikball nahezu unweigerlich einen Ball aus PVC kaufen.
Achte auf Weichmacher
Der größte Vorteil von PVC Kunststoffen ist gleichzeitig ihr größter Nachteil. Die hohe Flexibilität, welche bei Gymnastikbällen und Sitzbällen zwingend erforderlich ist, wird durch Stoffe verursacht, welche unter der Sammelbezeichnung als Weichmacher bekannt sind.
Während sich lange Zeit niemand an diesen Stoffen gestört hat, so ist in den vergangenen Jahren durch zahlreiche wissenschaftliche Studien bekannt geworden, dass Weichmacher ein sehr großes gesundheitliches Risiko darstellen. Allgemeine Aussagen können hier nicht getroffen werden, da die Zahl von unterschiedlichen Weichmachern groß ist und jeder der Stoffe eine teilweise deutlich andere Wirkung hat als andere.
Im Allgemeinen gelten viele Weichmacher als hormonähnlich. Ihre Aufnahme in den Körper kann also den Hormonhaushalt stören und vor allem bei Männern die Fruchtbarkeit verringern. Ganz besonders sind jedoch Kinder gefährdet. Durch die Störung des Hormonhaushalts kann die Entwicklung nachhaltig negativ beeinflusst und es können manche Organe geschädigt werden. Aus diesem Grund solltest du darauf achten, dass ein Ball, welcher für ein Kind gedacht ist, ausdrücklich als frei von Weichmachern bezeichnet wird.
Du selbst solltest beim Sport nach Möglichkeit Kleidung tragen, welche die Kontaktfläche deiner Haut zum Ball reduziert. Im Idealfall solltest du jedoch ebenfalls Gymnastikbälle und Sitzbälle ohne Weichmacher kaufen. Die Politik und die Industrie haben mittlerweile gut auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse reagiert. Kinderspielzeug darf EU-weit gar keine Weichmacher enthalten und auch sonst haben Kunststoffhersteller unbedenkliche Alternativen gefunden.
Die richtige Materialstärke und Belastbarkeitsgrenze
Wie bereits erwähnt, sind Gymnastikbälle aus einem wesentlich dickeren und somit stabileren Material gefertigt, als Sitzbälle. Die Dicke der Hülle kann bei einem hochwertigen Gymnastikball auch ohne weiteres bei 3 cm liegen um die benötigte Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten.
Der Nachteil ist jedoch, dass die Hersteller die Dicke der Hülle in der Regel gar nicht bestimmen und du diese Angabe somit in Produktbeschreibungen vergeblich suchen wirst. Dieses Kriterium entfällt also für die Bewertung der Qualität. Was du jedoch bei allen hochwertigen Sitzbällen und Gymnastikbällen finden wirst, ist die Angabe der Belastungsgrenze. Diese wird vom Hersteller getestet und hilft dir den passenden Ball für dich zu finden.
Die Belastungsgrenze von einem Sitzball braucht kaum höher als dein eigenes Gewicht zu sein. Ein Gymnastikball muss hingegen nicht nur dein Gewicht, sondern zusätzlich die Kraft von Stößen und ähnlichen Belastungen aushalten. Hochwertige Modelle haben deshalb, im Gegensatz zum Durchschnitt von 100 kg, eine Belastungsgrenze von 500 kg.
Darüber hinaus solltest du auf platzfestes („Anti-Burst“) Material achten. Falls der Ball doch einmal beschädigt wird, platzt er nicht schlagartig wie ein Luftballon. Vielmehr entweicht die Luft langsam und der Ball sinkt in sich zusammen.
Welche Größe sollte der Ball haben?
Die richtige Größe eines Sitzballs kannst du leicht an dir selber ausmessen. Da die korrekte Körperhaltung so aussieht, dass dein Unterschenkel und dein Oberschenkel einen 90° Winkel im Sitzen bilden, sollte der Sitzball vom Boden bis zur Kniekehle reichen oder etwas höher sein, um das leichte Einsinken zu kompensieren.
Bei einem Gymnastikball ist hingegen deine Körpergröße ausschlaggebend. Bis 1,40 m Körpergröße ist ein Gymnastikball mit 45 cm Durchmesser ausreichend, bis 1,55 m sind es 55 cm, bis 1,75 m sind es 65 cm, bis 1,85 m sind es 75 cm, bis 2,00 m sind es 85 cm und über 2 m Körpergröße sollte der Gymnastikball mindestens 95 cm groß sein.
Welches Zubehör solltest du kaufen?
Grundsätzlich benötigst du für einen Sitzball oder für einen Gymnastikball gar kein Zubehör. Wichtig ist jedoch, dass du den Ball aufpumpen kannst. Zu diesem Zweck brauchst du eine Pumpe oder, besser noch, einen Kompressor. Da vor allem große Gymnastikbälle ein sehr hohes Volumen von bis zu etwa 450 Litern haben, kann das Aufpumpen von Hand sehr lange dauern.
In Versuchen hat sich gezeigt, dass bei mechanischen Pumpen zumindest diejenigen für den Fußbetrieb schneller das gewünschte Ergebnis erbringen. Du solltest in jedem Fall darauf achten, dass du beim ersten Mal den Ball nur zu 80 % mit Luft füllst und ihm einen oder ein paar Tage Zeit gibst sich an die Beanspruchung anzupassen und langsam zu dehnen, bevor du ihn komplett füllst.
Ein anderes optionales Zubehör Teil ist eine Wandablage. Während der Sitzball problemlos dauerhaft im Zimmer verbleiben kann, nutzt du den Gymnastikball immer nur temporär gemäß seinem Verwendungszweck. In der übrigen Zeit wird er im Weg sein und kann ein Unfall- und Verletzungsrisiko darstellen.
Auch in einer Abstellkammer nimmer er viel Platz weg. Mit einer Wandablage kannst du den Ball platzsparend und sicher wegräumen. Für die Reinigung benötigst du hingegen keine bestimmten Mittel. Ein Lappen und etwas Seifenwasser reichen hierfür vollkommen aus.
Bekannte Hersteller
Wie bereits erwähnt, sind praktisch alle Sitzbälle und Gymnastikbälle von namhaften Herstellern qualitativ so ähnlich, dass du selbst in einer Kundenrezension kaum Anhaltspunkte darüber finden wirst, welchen Ball du wählen solltest. Du kannst selbstverständlich einen original Pezzi Ball von Ledragomma kaufen, welche als erste Gymnastikbälle seit 1950 hergestellt werden.
Wenn du einen Ball von Herstellern wie TOGU, Canway, MOVIT, Trenas oder Mirumb kaufst, kannst du jedoch ebenfalls nicht viel falsch machen. Exemplarisch sollen an dieser Stelle zwei der Unternehmen kurz vorgestellt werden.
Ledragomma / Tonkey
Das Unternehmen wurde im Jahr 1950 in der norditalienischen Stadt Osoppo gegründet. Damals war Latex eine Neuheit, vor allem im Bereich der Herstellung von Kinderspielzeug. So nutzte das Unternehmen diese Marktlücke um von Beginn an Gymnastikbälle unter dem Markennamen Pezziball herzustellen. So machte sich das Unternehmen einen Namen und produziert bis heute hochwertige Gymnastikbälle, wenn auch unter dem neuen Firmennamen Tonkey.
Togu
Hierbei handelt es sich um ein deutsches Unternehmen, welches im Jahr 1965 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Bayern in dem Ort Prien am Chiemsee. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von luftgefüllten Therapie- und Sportgeräten spezialisiert. So gehören Gymnastikbälle zu den wichtigsten Produkten.
Das Unternehmen, welches seine gesamte Produktion in Deutschland hat, entwickelte den, auf PVC basierenden Kunststoff Crylon, welcher die Gymnastikbälle des Unternehmens als platzsicher bekannt machte.
Andere Sportbälle
Gymnastikbälle solltest du immer als die großen, relativ leichten und flexiblen Bälle im Kopf behalten. Im Sportbereich gibt es zumindest noch zwei weitere Bälle, die gelegentlich als Gymnastikbälle bezeichnet werden. Die einen sind Faszienbälle. Diese bestehen zumeist aus Polypropylenschaum (EEP) und sind speziell dazu gedacht um damit Übungen für die Faszien durchzuführen.
Die anderen Bälle, die noch eher mit Gymnastikbällen verwechselt werden können, sind Medizinbälle. Sie sind sehr hart, sehr klein mit einem Durchmesser von nur rund 20 bis 30 cm und haben ein besonders hohes Gewicht von bis zu 10 kg. Sie werden gezielt für den Muskelaufbau und das Krafttraining während der Physiotherapie genutzt.